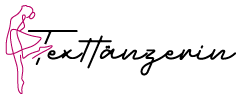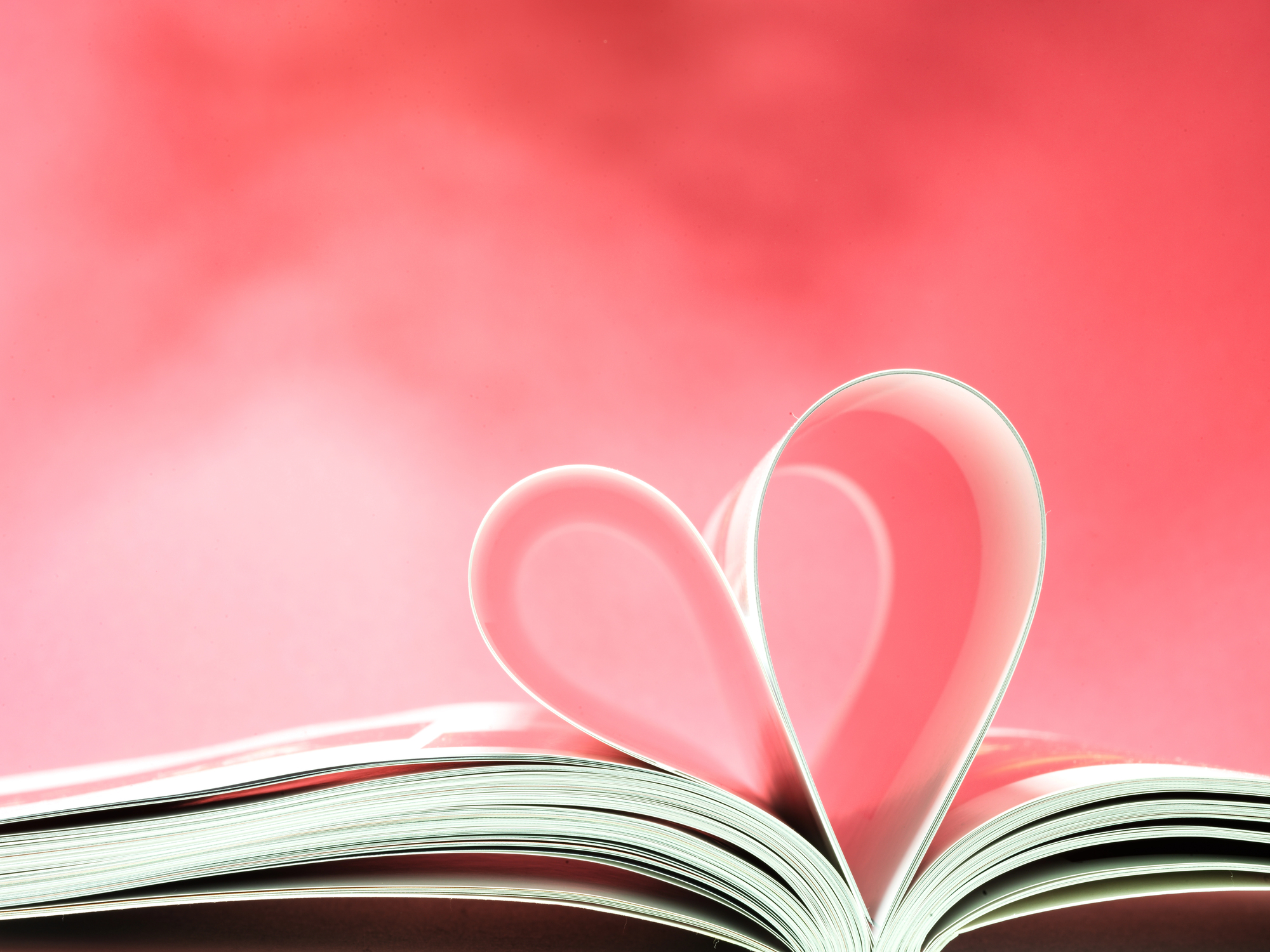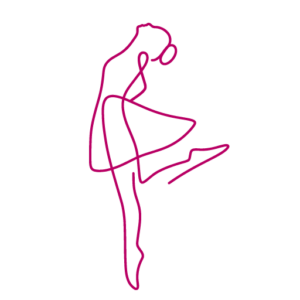Treffliche Tipps zur Vermeidung eines „Titelgates“ – Wie Autor*innen mit Kreativität und Empathie für die Zielgruppe das Herz von Leser*innen erobern können
„Champagnergate“ war gestern! Schon mal erlebt? Ein neues Buch erscheint, wird in den Medien beworben und klingt laut den Presseinformationen eigentlich nach etwas, das passen könnte, Lese-Vergnügen verspricht. Und dann, irgendwann wird einem bewusst, dass der Titel entweder langweilig ist oder als Trigger zur kategorischen Ablehnung wirkt …
Vom inneren Augenrollen und mehr
Das innere Augenrollen oder gar das Hochkommen des Mageninhalts – so halb wörtlich, wenn es ganz schlimm ist – kann schon auftreten, bevor Klappentext und/oder PR-Bericht überhaupt gelesen werden. Dann geht es noch schneller, dass Leser*innen eine Geschichte aus dem Hirn verbannen und nicht bestellen, kaufen oder lesen. Das ist natürlich nicht im Sinne von uns Autor*innen. Ein*e Leser*in ist für immer (für dieses Buch jedenfalls!) verloren. Obwohl er und/oder sie vielleicht sogar genau zur Zielgruppe zählen und Freude daran haben könnte. Ein Verlust für beide Seiten.
Was heißt das für Autor*innen? Wie können wir am besten auf unsere Geschichten aufmerksam machen? Leser*innen magisch anziehen? Und kein „Titelgate“ auslösen?
Titel mit Bedacht wählen
Ein zentraler Schritt für die Aufmerksamkeit der richtigen Personen ist ein genialer Titel. Der sollte im Hinblick auf die Zielgruppe mit Bedacht gewählt werden. Woran Autor*innen da denken und welche Aspekte in die Titelfindung einfließen können, schaue ich mir als Lektorin und Leserin jetzt einmal an. Es muss nicht jedes Detail eins zu eins für alle passen, aber eine Portion Inspiration kann nicht schaden. Vielleicht meldet sich ja schon die Fantasie mit einem passenden Titel, um die Zielgruppe möglichst anzulocken und sie nicht abzuschrecken.
Disclaimer und Lese-Leitfaden
Einen Disclaimer möchte ich noch anbringen (ja, ich mag das Wort irgendwie, obwohl es in diesem Fall etwas übertrieben ist): Die Überlegungen basieren auf meiner fachlichen Ausbildung, persönlichen Erfahrungen und einigen nerdigen Eigenheiten. Vermutlich können sie nicht jeden Aspekt oder gar Unteraspekt abdecken. Die erfundenen Beispiele und Anekdoten / anekdotischen Analysen echter Fälle sind eher dazu gedacht, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein dafür, was ein großartiger Titel vermag. Bewusstsein, wie Sprache und Ausdrücke auf Leser*innen wirken können. Und Bewusstsein dafür, wie wir Autor*innen uns bei der Titelfindung in unsere Zielgruppe einfühlen können.
Anekdote zum Zielgruppenbaustein „Filmnerds“
Möchten Autor*innen Filmnerds aus der Zielgruppe nicht ausschließen, ist Vorsicht geboten. Wir (ja, ich spreche aus Erfahrung!) sind manchmal ein bisschen schräg und haben so unsere eigene Weltsicht. So kann ein Titel, in dem „Remake“, in welcher Wortart auch immer, vorkommt (so geschehen bei einem aktuellen Sachbuch aus dem Bereich Gesundheit und Psychologie), schon mal dazu führen, dass Filmnerds nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen. Denn Remakes sind häufig nicht mehr so gut wie ein kultiges Original. Und wenn es dann noch um ein persönliches Remake, also eine Neufassung der Persönlichkeit geht …
Tja. Als Filmnerd fehlt mir der Glaube, dass ein Remake – eine Neuinterpretation – von mir / meiner Vergangenheit besser ist als das Original. Für viele andere mag die Idee von der Neudeutung der Vergangenheit ja verlockend klingen …
Wie die Zielgruppe tickt
Ja, Eigenheiten zeigen sich schon an uns Filmnerds, aber auch allgemein: Wir Menschen ticken nicht alle gleich. Manche sehen sich eher als Macher*innen, andere wiederum bevorzugen das Denken oder irgendwas dazwischen. Je nach persönlicher Ausprägung könnte die Reaktion auf einen Titel mit „remake“ (noch immer das Beispiel eines echten Sachbuches), also irgendwas mit „machen“, unterschiedlich ausfallen.
„Yeah, ich kann etwas tun und muss sofort herausfinden, was!“ lautet das Motto von Personen, die sich in der Rolle der Macher*innen gefallen. Will ich diese ansprechen, perfekt. „Ich muss was tun? Das könnte anstrengend werden …“ taucht vielleicht bei bequemeren Menschen auf. (Kommt mir in manchen Situationen bekannt vor.) Vielleicht wollen sie dann gar nicht mehr herausfinden, was. Ganz sensible Leser*innen – vor allem sprach(en)-sensible wie ich etwa – achten auf die Implikationen eines Appells à la „Mach was“. Im konkreten Fall des Sachbuches lautet der ja „Mach dich neu!“ Da wird eigentlich gesagt: „So wie du es jetzt machst, ist falsch. Du bist falsch. Und daher musst du dich neu machen, du musst dich oder zumindest deine Perspektive ändern.“ Nein, muss ich nicht. Buch wird nicht gekauft.
(Wobei es ja schon der Filmnerd in mir abgelehnt hat …)
Too much information
„Too much information“ ist das eine Extrem, das Leser*innen abschrecken kann. Mein Hirn spuckt da gerade fleißig ganz unangenehme und übertriebene Beispiele aus. „Die Wiese im Garten ist grün und neben dem Apfelbaum ist Katzenkacke“ etwa. Ein harmloses davon …
Ja, der Titel ist schräg und bekommt wahrscheinlich Aufmerksamkeit. Er bietet aber wenig relevante Informationen. Er geht vermutlich an der Zielgruppe vorbei, die sich bei einem Gartenratgeber etwas anderes wünscht. Die sich wünscht, dass ihre Fragen und Probleme aufgegriffen werden. Die eh schon wissen, dass eine Wiese im Regelfall grün ist. Oder die mehr Informationen brauchen, wie man einen Apfelbaum am besten pflanzt und pflegt. Ein solcher Titel vertreibt Personen, die nicht wissen wollen, wo die Katze ihr Geschäft verrichtet hat.
Too many Rätsel
Das Gegenteil von Informationsüberfluss – also zu viele Rätsel – kann ebenso eine undurchdringbare Barriere aufbauen. Oder die Funktion als Lockmittel nicht so ganz erfüllen. Als Leser*in hätte ich gerne eine leise Ahnung, worum es in einer Geschichte geht. Irgendein verbindendes Element zu Themen und/oder Figuren oder relevanten Fragen, die ein Buch stellt, kann Vertrautheit schaffen und das Interesse wecken.
Hundemenschen werden nicht unbedingt ein Buch mit dem Titel „Katze im Sack“ kaufen – weder dank des wörtlichen noch des metaphorischen Sinnes. Katzenmenschen springen vermutlich auf das Wort an. (Oder sehr wahrscheinlich der eigenen Erfahrung nach zu schließen.) Wenn es nicht gerade eine Geschichte ist, die irgendwie mit den süßen Fellnasen oder Säcken (!!!) in Verbindung ist, könnten sich Leser*innen allerdings ein wenig wundern. Sie stehen ja jetzt vor Rätseln. Andere Themen werden in diesem Beispiel nur indirekt – über die metaphorische Bedeutung – angesprochen. Ein richtiges Gefühl für die Inhalte kann sich kaum aufbauen. Dann braucht es ein passendes Cover und einen außergewöhnlich guten Klappentext, um über die eigentlichen Inhalte zu informieren und die Rätsel eines kryptischen Titels zu lösen. Gibt wohl noch viel schlechtere Beispiele …
PS: In manchen Genres wird gerne mit abstrakten Begriffen gearbeitet, die immer etwas rätselhaft daherkommen. Trotzdem sollten sie ein verbindendes Element zu den Geschichten schaffen.
Stilfrage(n) und Fallen
Was für den Ausdruck innen gilt, ist relevant für den Titel: Ein einheitlicher Stil weckt Interesse bei der Zielgruppe und schafft Vertrauen. Der Titel sollte einen Vorgeschmack auf den Inhalt geben. Und nicht in die Irre führen. Daher ist eine grobe Abweichung vom Stil des eigenen Buches nicht ratsam.
„Krasser Verhaltens-Stuff“ gibt ein falsches Versprechen, wenn im Benimm-Ratgeber im sachlichen Ton Regeln aus wohl vergangenen Zeiten besprochen werden. Im Text selbst auf Anglizismen, Jugendworte und zumindest annähernd moderne Sprache verzichtet wird. Nicht einmal ab und zu etwas „leiwand“, „cool“ oder „endgeil“ sein darf, sondern alles „schön“, „gut“, „bevorzugt“ oder gar „brav“ sein muss. Bisschen fad vielleicht und nicht der Stil, der im Titel verwendet wird. Hier klafft eine Lücke. Eine gefährliche. Denn Leser*innen, denen der Stil des Titels vertraut ist, die ihn schätzen, werden mit einer völlig konträren Ausdrucksweise konfrontiert, die mitunter weniger Anklang findet. Eine Rezension mit einem oder maximal zwei Sternen/Punkten droht. Umgekehrt werden Personen, die gerne mehr Sachlichkeit und weniger „Neumodisches“ mögen, das Buch vielleicht schon weglegen, wenn sie nur „krass“ lesen. Oder dann bei „Stuff“.
Augen-Abschreckung
Das Auge isst mit. Genauso bei der geistigen Nahrung. Vor allem, wenn diese Geschichten als Buch publiziert werden. Egal, ob Belletristik oder Sachbuch. Der Titel sollte sich gut ins Gesamtkonzept des Covers und der grafischen Gestaltung einfügen. Sonst könnte sich der Appetit auf Buch bei Leser*innen rasch wieder verziehen.
Braucht „Das 7-jährige Mädchen mit dem karierten Overall, das die Schule schwänzte und mit dem Bus ganz Amerika durchquerte“ am Cover zu viel Platz, dann ist der Titel nicht ideal gewählt. Sprich: Er kann maximal so gestaltet werden, dass die Schrift winzig und kaum lesbar ist. Auf einen Buchrücken, so Leser*innen die Geschichte in die Hand bekommen sollen, passt er fast gar nicht. Ob das ein geeignetes Lockmittel ist? Wenn „Am Ball der Bälle“ mit einem Bild von einem Haufen brauner Exkremente begleitet ist, ist das zwar ein anderer Aspekt. Die Diskrepanz zwischen Bild und Text könnte allerdings genauso stören oder zumindest verwirren. Da kann eine weitere Überlegung, ob es unbedingt dieser Titel oder genau das Bild sein sollte, nicht schaden.
Fazit:
Der Titel ist eines der ersten Elemente, die Leser*innen bei einem Buch ins Auge stechen. Und damit können Autor*innen in deren Köpfe kommen und sich in den Herzen festsetzen. Wenn der Titel stimmig ist. Wörter haben eine gewisse Wirkung, weshalb sich ein Einfühlen in die Zielgruppe lohnt.
- Welche Ausdrücke sind diesen bestimmten Personen bekannt und genehm?
- Welche Begriffe sorgen dafür, dass ein Buch noch vor dem Kauf oder dem Lesen weggelegt wird?
- Passt der Titel zum Stil?
- Bekommt er genügend Raum am Cover?
- Verspricht er zu viel? Zu wenig?
- Ist er klar genug?
- Oder geht er an den Bedürfnissen der Zielgruppe vorbei?
So viele Fragen. So viele Aspekte, die in die Titelwahl einfließen können. Damit die Brücke zu Leser*innen über den Titel gut gelingen kann.
PS: Die Titelfindung war besonders schwierig. Die habe ich mir diesmal bis zum Schluss aufgehoben. Ich hoffe, sie ist mir halbwegs gelungen …