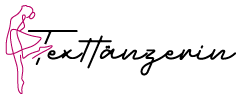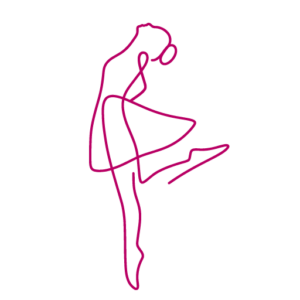Dialoge als fatale Fallen für Autor*innen –
Lebendigkeit und Logik müssen dank korrekter Inquits kein schreiender Widerspruch sein!
„Hahahahsschhudeeengsheen?“ „Wheichwhdiwhch!“ „Grrrdgrrdu!“ So in etwa würde sich so mancher Ausspruch in Romanen oder auch Sachbüchern eigentlich anhören, wenn man die Begleitsätze praktisch interpretiert. In dieser Form erst mal okay, denn direkte Rede ist Teil von Showing (und kein reines Telling). Da würde ich als Lektorin den Kontext ins Visier nehmen und wichtige Fragen stellen: Ist die Kenntnis der genauen Aussage für Leser*innen notwendig? Reicht es, die Atmosphäre des Gesprächs zu transportieren? Kommen Motivation und Gefühle der handelnden Figuren gut genug hinüber? Ist klar, wer spricht, oder wer, wie in diesen speziellen Fällen, nur sprach-ähnliche Geräusche in verschiedenen Schärfe- und Emotionsgraden von sich gibt?
Und was ist, wenn genaue Aussagen relevant für eine Geschichte sind?
Schauen wir uns genauer an, wie das am besten mit Dialogen beziehungsweise mit direkter Rede funktioniert!
Leben durch Geschichten und Dialoge
„Wir Autor*innen sind Geschichtenerzähler*innen und so soll es sein“, behaupte ich jetzt einmal. In Romanen, aber auch über Storytelling im Sachbuch. Geschichten können illustrieren, zur Identifikation einladen, zum Nachdenken anregen, uns berühren, unterhalten …
Die Liste, was wir Autor*innen alles bei Leser*innen auslösen können, lässt sich ergänzen, es gibt mehrere Sorten „Gefühle“ zur Entnahme. Diese können am besten rüberkommen, wenn unsere Geschichten lebendig und trotzdem nicht unlogisch sind. Man möge mir verzeihen, dass ich auf die ausgelutschte „Authentizität“ verweise. Nein, ich formuliere lieber um: Sind Geschichten voller echtem Leben, nachvollziehbar, nah an unseren Erfahrungen oder unserem Weltwissen, können sie mehr Wirkung entfalten. Ein Teil davon ist Kommunikation. Das kann mit direkter Rede, Gesten und ähnlichen Alternativen in Geschichten einfließen.
Aber Achtung: Besonders beim Sprechen, wenn es mit anderen Aktivitäten kombiniert werden muss, weil wir ja nicht 24/7 und ausschließlich quasseln im Leben, lauern Gefahren in Form von Logikfallen für Autor*innen.
Inquits als wertvolle Unterstützung, aber auch Stolpersteine in Dialogen
Leser*innen müssen in Dialogen nachvollziehen können, wer gerade spricht. Und meistens auch, was. Um bei direkter Rede Sprecher*innen zu markieren, kann man auf Inquits – also Redebegleitsätze – zurückgreifen. Richtig (und sparsam) eingesetzt, tragen sie zum Verständnis bei. Aber ganz so einfach ist das halt in der Praxis nicht mit diesen seltsamen Inquits. Vielleicht schon aus dem Schreibfluss heraus nicht, wenn die Köpfe von uns Autor*innen voll mit bunten Szenen sind. Nicht einmal, wenn man genau weiß, was „inquit“ bedeutet (und was nicht) …
Bildungs-Exkurs Inquits oder warum Autor*innen Inquit-Monster vermeiden sollten
„inquit“ ist die dritte Person Präsens Singular des lateinischen Verbs „inquere“, das schlicht und ergreifend „sagen“ bedeutet. Eine Inquit-Formel ist ein Begleitsatz, der aussagt, dass jemand etwas sagt. Er begleitet zumeist ein wörtliches Zitat, also die direkte Rede. Dann ist sie nicht so allein. Inquits sind sinnvoll, wenn es mehrere Sprecher*innen in einer Szene gibt und der Überblick über die Figur, die gerade etwas sagt, relevant ist und nicht so gut auf andere Art und Weise transportiert werden kann. Sie können auch eine indirekte Rede einleiten, aber das geht mehr Richtung Telling …
„Sagen“ ist für den Einsatz in erzählter Kommunikation gedacht, also fürs Sprechen. Daher ist es logisch, Verben zu benutzen, die die Aktivität des Sagens/Sprechens ausdrücken. Und nichts anderes! Easy, oder? Oder doch nicht? Um Licht ins Dunkel zu bringen, steige ich mit den Inquit-Monstern ein, die mir in meinem Berufsalltag oft begegnen. In verschiedenen Formen, denn Inquits können gänzlich unlogisch sein oder redundant (oder etwas dazwischen, wenn sie Texte stark verkomplizieren).
Lächelnde Leser*innen gibt es mit falschen Inquits nicht
Ja, vielleicht sind nicht alle Leser*innen extrem pingelig, was Logik betrifft. Für den Fall der Fälle darf man sich als Autor*in allerdings kein wohlwollendes Lächeln von ihnen erwarten, wenn Figuren plötzlich vollständige, verständliche Sätze „lächeln“ oder „grinsen“. Das ist anatomisch, euphemistisch ausgedrückt, einigermaßen schwierig. Beim deutlichen Sprechen brauchen wir mehr Mundöffnung, Lippenbewegung und unsere Stimmorgane (okay, Biologie ist nicht meine Expertise … aber für ein grobes Bild hoffentlich ausreichend). So strahlend das Lächeln sein mag, ohne es zu verändern, können wir Menschen nur Laute von uns geben, die maximal halb verständlich sind. „Iph liiiphe phich!“ oder gar nur „Mmch hmhm hmch!“, wenn Figuren keine Zähne zeigen möchten. So und kaum anders würde eine Liebeserklärung klingen … (Sieht noch jemand den Joker vor dem geistigen Auge?)
Klar kann es sein, dass wir im Gespräch einmal lächeln oder grinsen. Das zeigt unserem Gegenüber viel. Trotzdem braucht es zum verständlichen Reden mehr Mundbewegungen als fürs Grinsen oder Lächeln. Sprich: Grinsen/Lächeln ist nicht gleichzusetzen mit Sprechen. Eine einfache Lösung: Die beiden Aktivitäten können Autor*innen gerne getrennt beschreiben, um Leben in eine Geschichte zu bringen:
„Ich liebe dich!“, sagte Manuela und lächelte. Vielleicht grinste sie auch, weil sie die andere Figur mit der Liebeserklärung überrascht hat. Oder leiser für mehr Abwechslung: „Ich liebe dich“, flüsterte Manuela und lächelte. Dem Lächeln/Grinsen könnte man eventuell einen eigenständigen Satz widmen, unter Umständen ist die Inquit-Formel dann gar nicht mehr notwendig. Manuela lächelte. „Ich liebe dich!“ (Dann folgt die verbale oder nonverbale Antwort des Gegenübers.)
Ungewollte Komik ihshst nicht ganz sohoho genial
„Dahahahhahaaass ihshst sohoho uhuhuhuhunlohohogihihisch!“ So oder so ähnlich stelle ich mir die mögliche Reaktion heikler Leser*innen vor, wenn in einer Geschichte steht, dass eine Figur ihren Satz – der ganz ‚normal‘ klingt und vollkommen verständlich ist – lacht oder kichert. Die Tätigkeiten Lachen/Kichern und Sprechen können nur getrennt voneinander ausgeführt werden, wenn das Gesagte verständlich sein muss, weil es für die Story/die Figur relevant ist.
Als sich Alex vom Lachkrampf beruhigt hat, murmelt er: „Das ist so unlogisch!“ Kürzer geht auch. Alex lacht. „Das ist so unlogisch!“ Vielleicht legt er sogar das Buch weg …
Ähnlich geht es Susi. Sie kichert und kriegt sich kaum ein. „Das ist so unlogisch!“
Tieftraurig ist menschlich, aber gefährlich für Autor*innen – Weinen & Co.
Ich traue mich jetzt über kein onomatopoetisches Beispiel fürs Weinen von „Sie ist verschwunden!“ drüber. Es tut mir leid. Bitte die eigene Erfahrung und Fantasie benutzen! Sobald der Film im Kopf begonnen hat, wird klar, dass geweinte, gejaulte oder geschluchzte Sätze wenig verständlich sind. Das müsste rein logisch in der direkten Rede abgebildet werden und sie sollte im Idealfall die Tätigkeit so gut illustrieren, dass das Inquit obsolet wird. Ist die konkrete Aussage wichtig, ist das keine gute Lösung. Einen geschluchzten Satz können weder die anderen Figuren in der fiktiven Welt noch Leser*innen deutlich verstehen. Also geben wir Autor*innen den Figuren lieber etwas Zeit, damit sie sich vom Heulen oder Weinen beruhigen können, um die gesprochene Erklärung zu liefern. Oder lassen wir sie nach der Erklärung zusammenbrechen und das Schluchzen nachher beginnen.
„Sie ist weg!“, flüsterte Mario, während ihm die ersten Tränen übers Gesicht liefen.
Schauen wir zu Silke! Die ältere Frau schluchzt. „Sie ist weg!“, stammelt sie. (Vielleicht funktioniert es noch besser ganz ohne Inquit, indem man das leichte Zittern in der Stimme in der direkten Rede abbildet: Silke schluchzt. „S-sie i-ist w-weg!“)
Geräusche, die nur in gewissen Genres beheimatet sind – Stöhnen & Co.
Welch Ironie! Leser*innen könnten bei gewissen Szenen ähnliche Geräusche wie die ausstoßen, die die Figuren laut Inquit-Formel machen, obwohl die direkte Rede gut verständlich ist. Geräusche oder Laute, denn ausschließlich solche kommen im echten Leben beim Seufzen, Stöhnen oder Keuchen hervor. Allerdings keine vollständigen, klar verständlichen Sätze. Mit Ausnahme von „Oh!“ und „Ah!“ vielleicht, die aber gestöhnt oder geseufzt wirklich nur in bestimmten Genres, in Sex-Szenen, halbwegs logisch eingesetzt werden können. Sonst gilt: erst die Erklärung, wenn es von der Reihenfolge logisch so passt, dann die geräuschvolle Reaktion. Oder umgekehrt: Figuren zuerst von der Plage des Seufzens, Stöhnens oder Keuchens erholen lassen – mit dem Punkt am Ende des eigenständigen Satzes, dann ist genügend Luft da, um deutlich zu sprechen.
Braucht es ein Beispiel? Nora keuchte. „Ich dachte, Hula-Hoop wäre einfach!“ Ganz allgemein: in Analogie zu ähnlich gelagerten Fällen.
Nicken oder andere stumme Aktivitäten als No-Go-Inquits
„“, nickt er. So müsste es richtig sein, denn Nicken ist geräuschlos. Nicht so selten wie von aufmerksamen Leser*innen gewünscht, greifen Autor*innen jedenfalls auf Tätigkeiten zurück, die nichts mit Sprechen zu tun haben, um eine direkte Rede als Inquit zu begleiten. Nicken ist stumm. Kopfschütteln auch. Oder hört man bei Letzterem automatisch ein „So geht das nicht!“? Eher nicht …
Gerade in solchen Fällen, bei denen eine andere Handlung im Vordergrund steht, lassen sich eventuell Lösungen ganz ohne Inquit finden. Joni nickt. „Ich habe ihn im Kaffeehaus getroffen.“ Da gibt es wohl noch bessere Alternativen, denn die direkte Rede ist schon eine Bestätigung, das Nicken vielleicht nicht einmal notwendig oder umgekehrt. Genauer hinschauen und kreativ werden, lautet in einem solchen Fall die Profi-Empfehlung. Und bitte keinen vollständigen Satz nicken lassen …
Redundant oder zu kompliziert
„Bitte geht nicht!“, flehte Anna inbrünstig mit vor Verzweiflung stark zitternder, dünner Stimme. „Bitte nicht!“ Das könnte man bei einer solchen Beschreibung ebenfalls denken, die überkonstruiert daherkommt. Adverbien, Adjektive und sämtliche Zusätze stehen in einer solch geballten Form dem Lesevergnügen entgegen. Zu viele davon machen Sätze kompliziert, verlangsamen das Tempo und klingen überfrachtet.
In diesem Fall kann die direkte Rede alleinstehen, sie ist nah am Flehen, das Zittern in der Stimme könnte man direkt abbilden. „B-bitte geht n-nicht!“ Anna sprang auf und eilte ihnen hinterher – eine mögliche Reaktion. Vielleicht macht sie auch etwas ganz anderes …
Fazit:
Der sparsame und gezielte, auf Logik beruhende Einsatz von lnquits, die nah am praktischen Leben sind, gibt Leser*innen Orientierung, welche Figur spricht. Das trägt zum Verständnis bei und erhöht den Lesefluss. Sind Inquits, wenn man sie praktisch interpretiert, unlogisch, weil sie keine Art von Sprechen ausdrücken, wird es für Leser*innen maximal ungewollt komisch. Ja, einige wenige falsche Inquits sind kein Weltuntergang, aber pingelige Leser*innen könnten dennoch die mangelnde Logik kritisieren. Findet man sie als Autor*in nicht selbst, dann können Profis eingreifen und sie aufspüren.
Bonus: Manchmal machen Alternativen die Szenen sogar noch lebendiger.